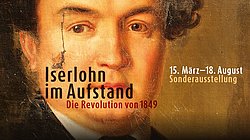Herzlich willkommen auf der Homepage der Städtischen Museen Iserlohn
Aktuelle Sonderausstellung im Stadtmuseum
Iserlohn im Aufstand. Die Revolution von 1849
15. März bis 18. August 2024
Weitere Informationen finden Sie hier.
Stadtmuseum ist Ort der Demokratiegeschichte
Das im ehemaligen Zeughaus untergebrachte Stadtmuseum ist in die virtuelle Deutschlandkarte der Orte der Demokratiegeschichte aufgenommen worden. Darin sammelt die Arbeitsgemeinschaft Institutionen, Gebäude und Plätze, die zur Entwicklung der Demokratie in Deutschland seit dem 18. Jahrhundert beigetragen haben.
Iserlohn spielte als eine der bedeutendsten Industriestädte Westfalens im 19. Jahrhundert eine wichtige Rolle bei den revolutionären Ereignissen von 1848/49. Am 10. Mai 1849 stürmten Iserlohner Bürgerinnen und Bürger das Zeughaus, um die Einkleidung und Bewaffnung der Landwehr durch Preußen zu verhindern. Eine Woche lang verhinderten Iserlohnerinnen und Iserlohner durch den Bau von Barrikaden, der Wahl zweier Sicherheitsausschüsse und der Entsendung einer Delegation nach Münster die Niederschlagung des Aufstands, erst am 17. Mai wurde die Stadt von preußischen Truppen gestürmt.
Die Erinnerung an die revolutionären Ereignisse von 1849 ist dem Stadtmuseum ein besonderes Anliegen. Iserlohn kann stolz darauf sein, dass ehemalige Bürgerinnen und Bürger demokratische Prozesse nicht nur rezipiert, sondern selbst mitgestaltet haben.
Mehr Infos zu den Orten der Demokratiegeschichte und zum Eintrag des Stadtmuseums finden Sie hier.
Iserlohn: Objekte aus aller Welt?
Herkunft unter der Lupe
Was erzählen die Gegenstände über ihre Entstehungs- und Erwerbungszeit? Wie, wo und von wem wurden sie erworben?
Die digitale Ausstellung „‘Aus fremden Erdteilen. Geschenkt v. Söhnen der Heimat‘ - Objektwege nach Westfalen-Lippe“ nimmt museale Objekte aus außereuropäischen Kontexten unter die Lupe. Die Geschichten hinter Teilbeständen von vier Museen aus Westfalen-Lippe werden hier vorgestellt.
Gemeinsam mit den beteiligten Museen – Iserlohn, Menden, Lünen und Lemgo – wurden die Sammlungen auf außereuropäische Bestände untersucht. Die Objekt- und Sammler:innenbiografien zeigen, welche unterschiedlichen Wege museale Dinge zurücklegen und das selbst in kleineren Museen – abseits von Berlin, Köln, Hamburg oder München – Objekte zu finden sind, die mit kolonialen Kontexten in Zusammenhang stehen.
Aus Iserlohn werden Souvenirs des Patenschiffs der Stadt Iserlohn aus den 1950ern sowie ein Seidenstickbild, welches aus der Ostasiatika-Sammlung des ehemaligen Kapitänsleutnants Dietrich Görke stammt, gezeigt. Mit dem Patenschiff kamen unter anderem ein Trommler aus Haiti, eine kleine silberne Glocke und eine Silberschale aus Mexiko durch den Kapitän Erich Schwarzbürger in die Stadt Iserlohn. Das Seidenstickbild aus der Sammlung Dietrich Görke kam in den 1970ern in die Museumssammlung. Solche Stickereien waren beliebte Mitbringsel und sind zum Beispiel auch in Detmold und Hagen vorhanden.
Die digitale Ausstellung können Sie hier besuchen.

In drei markanten denkmalgeschützten Räumlichkeiten wird die vielfältige Kultur-, Industrie- und Stadtgeschichte Iserlohns hautnah erlebbar:
- Eines der bedeutendsten Barockgebäude Iserlohns beherbergt das Stadtmuseum.
- Der ehemalige Adelssitz Haus Letmathe präsentiert im Obergeschoss eine Ausstellung zur Alltags- und Handwerksgeschichte.
- Die Historische Fabrikanlage Maste-Barendorf gilt mit dem Nadelmuseum und der Haarnadelfabrik als bedeutender industriekultureller Standort und ist zudem als Künstlerdorf weit über die Grenzen Iserlohns bekannt.
Weiterhin betreut das Stadtmuseum den ehemaligen Luftschutzstollen Altstadt am Fritz-Kühn-Platz, unterhalb der Obersten Stadtkirche.